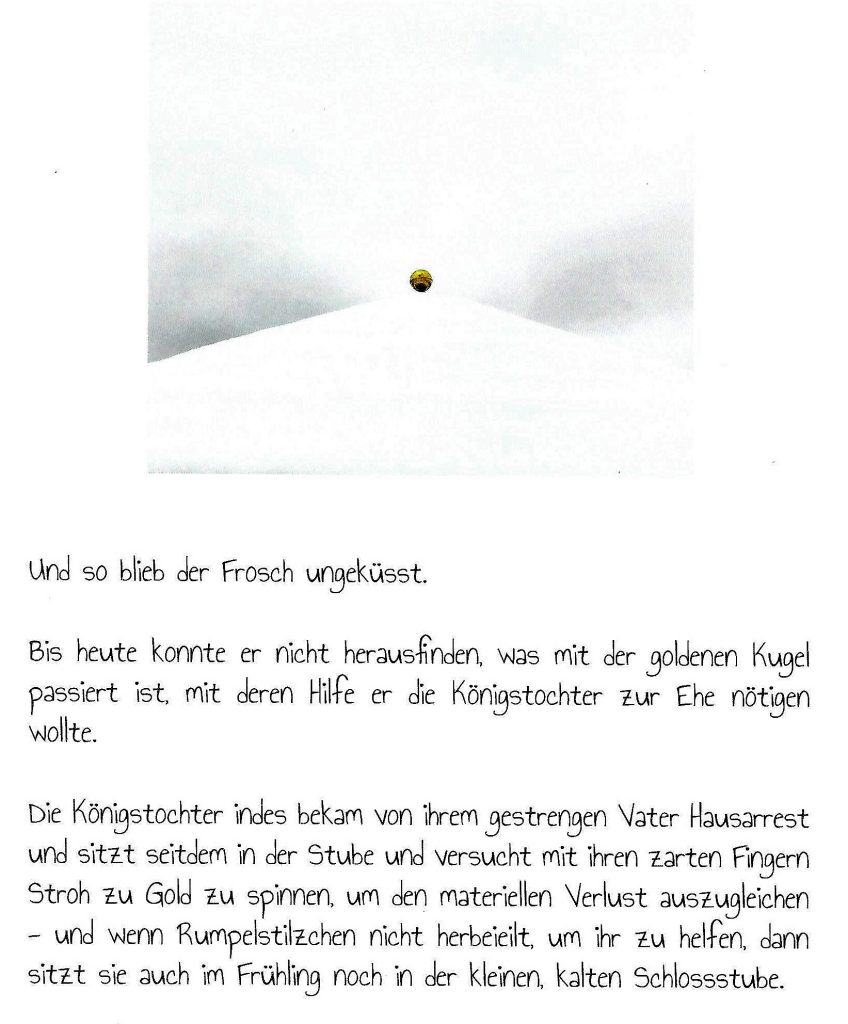Berlin, 30.01.1921, Sonntag
Die Forderungen der Siegermächte sind nun öffentlich. Ab Mai sollen 226 Milliarden Goldmark gezahlt werden, verteilt auf zweiundvierzig Jahre. Darüber hinaus sollen zwölf Prozent des Wertes der deutschen Ausfuhr an die Entente abgeführt werden.
In der Straßenbahn, im Café, überall diskutieren die Menschen. Die erregten, schockierten und wütenden Menschen fürchten um ihre Zukunft. Die Regierung Fehrenbach erklärte die Forderungen für unerfüllbar. Wie soll Deutschland zahlen, solange seine Wirtschaft am Boden liegt? Ein armes, elendes Deutschland ist den Siegermächten schwerlich von Nutzen.
Aber die Entente zeigt keine Nachsicht, sie droht mit der Besetzung des Ruhrgebietes, wenn nicht geliefert wird. Diese Maßnahme ist im Versailler Vertrag vorgesehen.
15.07.1920, Donnerstag
Werner und ich haben die Dada-Messe der Galerie Burchard am Lützow-Ufer besucht und dort die surrealen, grotesken Exponate von Rudolf Schlichter, Max Ernst, Otto Dix und George Grosz gesehen.
Radke verurteilte die Ausstellung mit harten Worten:
„Ein Schaffen, das ausnahmslos gegen alles wirkt, das alles bekämpft, alles ins Lächerliche zieht, das keine Blasphemie und Beleidigung auslässt, ist nicht als Kunst zu betrachten. Es ist richtig, dass man versucht, gegen diese Leute vorzugehen. Heartfield und Schlichter gehören wegen Gotteslästerung und Beleidigung vor ein Gericht. Der preußische Erzengel gehört als Müll verbrannt, diese Figur hat absolut nichts mit Kunst zu tun.“
Ich denke, wenn ein Werk die Sicht des Künstlers auf die Beschaffenheit der Welt darstellt, selbst wenn er ungewohnte Mittel wählt, um diese neue, verwirrende Welt dem Betrachter zu vermitteln, dann hat er ein Kunstwerk erschaffen. Selbst wenn diese Kunst den Betrachter schmerzt oder beleidigt. Ich bin gewillt, die Dadaisten als Künstler ernst zu nehmen, allerdings scheint es mir, als würden sich manche selbst nicht ernst nehmen. Eine Kunst, die alles verneint, selbst ihre eigene Berechtigung als Kunst, ist eine schwierige Kunst.
Mich erinnert diese Kunst an den Krieg. Zerfetze, unvollständige Körper. Das Stakkato der dadaistischen Sprache weckt die Erinnerung an das akustische Inferno der Kriegsfront. Es ist aber eine Erinnerung, die ich fliehen möchte, ein Kunsterlebnis, das mir nicht dabei hilft, die Erinnerung an den Krieg zu verarbeiten. Allerdings geben Kritiker an, der Dadaismus wolle weniger den vergangenen Krieg als die gegenwärtige Welt beschreiben. Die hektische Arbeit in den Fabriken, die schrillen Vergnügungen, den zunehmenden Verkehr der Großstädte
06.06.1920, Sonntag, Wahltag
Heute wurde der erste republikanische Reichstag gewählt.
Mir scheint, dass weniger zur Wahl gingen als vor eineinhalb Jahren. Die Straßen waren ungewöhnlich ruhig für Berlin an diesem Morgen.
07.06.1920, Montag
Die Wahl zeigt, wie unzufrieden das Volk mit der Regierung ist. Diejenigen, die die Republik tragen sollen, die Parteien der Weimarer Koalition, schreiben die meisten Verluste.
21.05.1920, Freitag 
Abends spazierten Elsa und ich durch den Tiergarten. Sie ist voller Sorge um Phillip und zweifelt, ob sie die Eltern einweihen soll. Der Bruder hatte sie am Vorabend besucht. Die Brigade Ehrhardt ist aufgelöst. Phillip kam, um sich zu verabschieden. Nun ist er mit Kameraden auf dem Weg nach München, um sich einer militärischen Organisation anzuschließen, die die Ziele der Brigade Ehrhardt weiter verfolgt.
Ich riet Elsa, die Eltern zu informieren. Nichts ist schlimmer als die Ungewissheit.
Am Nachmittag bin ich wieder dem Kriegsblinden begegnet. Er sitzt oft an der Ecke Bellevuestraße, wo die Siegesallee beginnt. Den niedrigen Schemel rückte er wie immer nach der Sonne. Der alte Militärmantel berührte den Boden, als er so dasaß und auf seiner Ziehharmonika spielte. Kein Gesang. Den Kopf hielt er gesenkt, kaum eine Regung, wenn eine Münze in den Blechbecher fiel. Ab und zu machte er Pause und beugte sich zu seinem Hund hin, der zu seiner Rechten auf einer weichen Decke ruhte. Der Alte lächelte, sprach freundlich mit dem Tier und streichelte das zottige, braune Fell. Ich gab noch eine Extramünze für den Hund.
20.05.1920, Donnerstag 
Ich habe Werner im Café Vaterland getroffen. Er ist tief gekränkt und in trüber Stimmung. Keine seiner Collagen wurde zur Dada-Ausstellung zugelassen. Dabei lief er seit Wochen Grosz wie ein Hündchen hinterher. Ein bissiger, kleiner Hund, der jede Äußerung seines Herrn lautstark und grell bebellte. Ich habe ihn beobachtet, im Gefolge von Grosz. Sie nehmen ihn nicht als ihresgleichen an und seine Collagen nicht ernst. So ist zur Kunst des Dada doch mehr vonnöten als blanke Wut. Werner nimmt sich selbst zu wichtig und zu ernst, um wirklich bei den Dadaisten anzukommen.
An mir hat Werner einen eigenartigen Narren gefressen. Oder sieht er nur den Sohn seines Gönners? Einmal riet ich ihm, doch wieder zur impressionistischen Malerei zurückzukehren. Deutsche Maler, die die Natur in impressionistischer Leichtigkeit malten, seien nach wie vor gefragt und würden in den Galerien gern genommen. Ich könnte mich für ihn bei Radke verwenden. Er wies mein Angebot empört zurück. Er sei Künstler und kein Auftragsmaler.
13.03.1920, Sonnabend
Schwarz-weiß-rote Fahnen hängen am Reichstag. Sie marschieren wieder. Die öffentlichen Gebäude sind besetzt.
Man sagt, die Regierung sei nach Stuttgart geflohen.
Ein Knabe verteilt ein Flugblatt, das von Ebert unterschrieben ist:
Arbeiter! Genossen! Wir haben die Revolution nicht gemacht, um uns heute wieder einem blutigen Landsknechtsregime zu unterwerfen. Legt die Arbeit nieder! Streikt! Schneidet dieser reaktionären Clique die Luft ab! Kämpft mit jedem Mittel für die Erhaltung der Republik! Lasst allen Zwist beiseite. Es gibt nur ein Mittel gegen die Diktatur Wilhelms II: Lahmlegung jedes Wirtschaftslebens! Keine Hand darf sich mehr rühren! Kein Proletarier darf der Militärdiktatur helfen! Generalstreik auf der ganzen Linie! Proletarier, vereinigt euch! Nieder mit der Gegenrevolution!
11.03.1920, Donnerstag
Putsch gegen Ebert!
Der Berliner Lokalanzeiger berichtet von einem geplanten Putsch gegen die Regierung. Der Versailler Vertrag fordert die Reduzierung des Heeres von 400.000 auf 100.000 Mann und die Auflösung der Freikorps. Lüttwitz weigerte sich, die Freikorps aufzulösen. Daraufhin setzte Noske ihn ab. Man sagt, Lüttwitz sei auf dem Wege nach Döberitz zur Brigade Erhardt. Er werde nicht dulden, dass ihm eine solche Kerntruppe in einer so gewitterschwülen Zeit zerschlagen werde. Er plane, die Regierung aus Berlin zu vertreiben. Die Gruppe „Nationale Einheit“ um Kapp und Ludendorff halte sich bereit, noch in der Nacht zum Sonnabend den Reichstag zu übernehmen. Eine Militärregierung soll eingesetzt werden.
Ich kenne Ludendorff. Er bewohnt ein vornehmes Patrizierhaus in unserer Straße. Man kann ihn beim Spaziergang im Tiergarten treffen. Ihm haftet etwas durch und durch Napoleonisches an. Selbst in Zivilkleidung erahnt man den Militär. Beim Frühstück im Esplanade macht er keinen Hehl aus seiner Verachtung für den Zivilen Ebert und seine Republik. Er hat der Politik nie verziehen, dass sie einen Friedensvertrag ausgehandelt hat. Die Sozialisten in der Heimat hätten das deutsche Heer um die Früchte des Sieges betrogen.
05.01.1920, Donnerstag
Die Arbeitslosigkeit nimmt zu. Die letzten Kriegsgefangenen kehren heim.
Überall auf den Straßen sieht man hagere, müde Männer mit Pappschildern Suche Arbeit.
Heute wurde das Reichsamt für Arbeitsvermittlung eröffnet. Viele hoffen auf Friedrich Syrup vom Demobilisierungsministerium und darauf, dass es ihm gelingt, die Kriegsheimkehrer in Brot und Arbeit zu bringen
{
13.01.1920, Dienstag 
Die Arbeiter demonstrierten am Mittag auf dem Königsplatz. Sie fürchten um ihre Rechte. Es war eine große Menschenmenge, Männer und Frauen. Selbst auf meinem Heimweg durch den Tiergarten traf ich noch auf Demonstranten. Die Stimmung war angespannt und gereizt, auch Schüsse fielen.
Später berichtete das Berliner Abendblatt von zweiundvierzig Toten und vielen Verletzten. Politiker von USPD und KPD wurden verhaftet.
Ich denke an Fritz. Ob er sicher ist in Moskau?
Am Abend sagte Elsa, dass ihr Bruder Phillip nach Döbritz gegangen sei, um sich den Feldgrauen der Brigade Ehrhardt anzuschließen. Er könne den falschen Frieden der Republik nicht ertragen. Er wolle der radikalen Linken die Stirn bieten – und das mit militärischen Mitteln. Elsa fürchtet um den Bruder, der sich weit von ihr entfernt hat.
… Bei Phillip war es sicher nicht die Flucht vor einer geregelten Arbeit, die ihn bewogen hat, alle bürgerlichen Beschäftigungen abzulehnen. Es ist die Sehnsucht nach der ehrlichen, aufrichtigen Kameradschaft, nach einer Ordnung, die ihm Berlin in seiner Zerrissenheit nicht geben kann.
10.01.1920, Sonnabend
Der Frieden ist nun tatsächlich gemacht. Der Friedensvertrag von Versailles ist unterschrieben. So wird man nun die Forderungen des Vertrages erfüllen müssen.
Beim Frühstück im Adlon am Brandenburger Tor diskutierten am Nebentisch Geschäftsleute den Vertrag. Sie waren sich einig: Deutschland wird die Forderungen des Vertrages niemals erfüllen können. Die Hälfte der Eisenerzförderung und ein Viertel der Steinkohleförderung soll als Wiedergutmachung an die Entente geliefert werden. Dazu siebzehn Prozent der Kartoffelernte und dreizehn Prozent der Weizenernte. Dabei wurden die großen Ländereien im Osten an Polen gegeben. Womit soll das Reich seine Bürger ernähren? Darüber hinaus muss Deutschland Leistungen in Geld, Gold und Sachleistungen erbringen: Lokomotiven, Schiffe, ja ganze Industrieanlagen gehen nach Frankreich und England. Wie soll das Volk wieder auf die Beine kommen? Viele meinen, die Regierung und das Volk müssen gegen den Vertrag sprechen. Dazu die Demobilmachung. Keine Marine, keine Flugzeuge, keine Panzer. Eine Demütigung! Ein Staat ohne schlagkräftige Armee ist kein richtiger Staat, sagen die Nationalen.
Es herrscht immer noch Hochwasser an Rhein und Mosel. Die Schifffahrt wurde eingestellt, dadurch gibt es kaum noch Kohlelieferungen nach Berlin und das mitten im Winter. Die Rohstoffe sind knapp und teuer. Von Wilhelm weiß ich, dass das Rheinland lieber gegen Devisen ins Ausland liefert. Die Reichsmark verliert immer mehr an Wert, je stärker die Regierung die Notenpresse einsetzt, um den Haushalt auszugleichen.
Die Berliner Betriebe fordern von ihren Arbeitern mehr Arbeit für weniger Lohn. Es gibt wieder Streiks in Berlin.

03.01.1920, Sonnabend
Keine Züge aus dem Ruhrgebiet. Streik der Eisenbahner überall im Reich. Die Gewerkschaft begründet den Streik mit der wachsenden finanziellen Not ihrer Mitglieder.
1920
01.01.1920, Donnerstag
Mit großem Spektakel hat Berlin das neue Jahr begrüßt.
Ich habe Ernst zum Silvesterball im Palmensaal des Esplanades begleitet. Zwar gibt es seit März als Folge des Belagerungszustandes wieder ein Tanzverbot, aber die Berliner kümmert das wenig. Es war turbulent. Ernst ist ein guter Tänzer, er könnte im Esplanade wohl auch Geld als Eintänzer verdienen. Die Damen der Gesellschaft schienen recht vertrauten Umgang mit ihm zu haben. Sie mögen sein vornehmes Benehmen, seine schlanke Figur, die wohlformulierten Komplimente. Ich hoffe, er gibt Margarete keinen Grund zur Eifersucht. Vielleicht werde ich mit der Schwester reden. Sie sollte Ernst zu diesen Anlässen begleiten, anstatt zu Hause Teegesellschaften zu geben.
Den Schwager hielt es nicht lange auf dem Ball. Und so zogen wir in einer fidelen Gruppe weiter in eines der Lokale, wie es jetzt viele in Berlin gibt. Wo bis morgens getanzt und getrunken wird. Hier verkehren Geschäftsleute und Unternehmer, die in einer Nacht ein Vielfaches von dem ausgeben, was ihre Arbeiter in einem Monat verdienen. Dazwischen die Mädchen, die auf eine einträgliche Bekanntschaft hoffen. Und die mittellosen Künstler, die dem Reichtum hofieren in der Hoffnung auf einen Mäzen oder nur ein reichhaltiges Mahl.
So ist Berlin: Hier das wilde Tanzen und Vergnügen, rastlos und zügellos, und daneben die Millionen in großer Not.
Heute Morgen im BT die Neujahrsansprache des Reichspräsidenten. Ebert fordert alle Deutschen auf, in der Not zusammen zu stehen und gemeinsam jeder da, wo er stehe, für den Wiederaufbau des Vaterlandes sein Äußerstes zu tun. Werden die Demokraten ihm folgen? Seinen Worten fehlte das Pathos, das das deutsche Volk so sehr liebt.

Witten, 26.12.1919, Freitag, Weihnachten
Hochwasser an Rhein, Mosel und Main. In Köln wurde der Hafenverkehr eingestellt. Wilhelm befürchtet, dass schon bald die Ruhr über die Ufer treten könne. Er überlegt, das im Tal gelegene Werk zu räumen.
Für die nächsten Tage ist zudem strenger Frost vorausgesagt. So wird der Vater vorerst nicht mit nach Berlin kommen.
Margarete plant ebenfalls, noch länger in Witten zu bleiben und Auguste etwas zur Hand zu gehen. Als ob Auguste die Hilfe ihrer Schwägerin benötigt! Es ist wohl eher das alte Heimweh, das Margarete die Abreise hinausschieben lässt.
Mich braucht Radke in Berlin. Die Hängung für die Ausstellung beginnt. Ernst wird mich begleiten, er möchte ungern auf die Silvesterfeiern in Berlin verzichten. Als er sich leichten Herzens von Margarete und den Mädchen verabschiedete, meinte er augenzwinkernd:
„Man erwartet, dass ich in der Illustrierten Wochenzeitung exklusiv über die Silvesterspektakel berichte.“
Witten, 25.12.1919, Donnerstag, Weihnachten
Erste Friedensweihnacht seit 1914. Und die erste Weihnacht ohne die Mutter und Ludwig. Dank meiner Nichten und Neffen sind es dennoch fröhliche Weihnachtstage. Viel Lachen und leichtes Plaudern. Paul freute sich unbändig, seine kleine Freundin Elise wieder zu sehen. Marie-Cläre ist nun auch schon ein halbes Jahr alt. So lange ist die Mutter schon tot. Augustes Wunsch nach einem Mädchen hat sich nicht erfüllt. Im September wurde Heinrich geboren. Es gab Scherze und Späße über das ungerechte Schicksal, das beiden Familien das falsche Baby bescherte. Ob man nicht tauschen solle. Natürlich meint niemand dies ernsthaft. Einzig mein Schwager hielt sich zurück, er scheint immer noch zu grollen, weil ihm bis heute kein Stammhalter vergönnt ist.
Das politische Reden war ruhiger als die letzten Jahre. Als würde auch in unserer Familie so langsam der Frieden einkehren. Der Vater war sehr angetan von meiner Empfehlungsliste. Er wird die Bilder selbst in Augenschein nehmen und plant, uns nach den Festtagen nach Berlin zu begleiten. Nur Wilhelm kommt mir angespannt und niedergeschlagen vor. Er nimmt sich kaum Zeit für eine ruhige Mahlzeit. Eilt auch während der Feiertage immer wieder zur Fabrik. Beim Nachmittagsspaziergang sprach ich Auguste darauf an. Sie erzählte, dass ihn die Bedingungen des Friedens bedrücken.
„Die Demobilmachung. Man verlangt nun von unseren Arbeitern, dass sie die Granaten, die sie einst gebaut haben, selbst zerstören. Das ist hart. Es trübt die Stimmung und die Arbeitsfreude. Außerdem gibt es einen Mangel an billigen Arbeitskräften zu beklagen. Unsere Fremdarbeiter aus dem besetzten Belgien sind heimgekehrt, und die Sprecher der deutschen Arbeiter fordern mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Der Achtstundentag ist ein gutes Beispiel. Die Gewerkschaften machen den Arbeitern Versprechen und die Unternehmer müssen nachher dafür gerade stehen.“
Ich war erstaunt, wie sachkundig Auguste über diese Angelegenheiten sprach. Kumpelhaft hängte sie sich bei mir ein, prüfte, ob das Kindermädchen mit dem Kinderwagen nachkam und meinte lächelnd:
„Allerdings brauchen wir uns um die Zukunft keine Sorgen zu machen. Es sind viele da, die Brot und Arbeit brauchen. Und zu tun gibt es auch genug. Der Vater hat Wilhelm Aufträge aus dem Ausland vermittelt. Außerdem werden Kohle und Stahl immer gebraucht. Wilhelm hat große Pläne im Maschinenbau: Teile für Lastwagen, Lokomotiven. Und die Linke ist ja wohl endgültig geschlagen und das Gespenst der Enteignung damit auch.“
05.12.1919, Freitag
Gestern ging ich auf dem Heimweg von Radke am König Wilhelm Gymnasium in der Viktoriastraße vorbei. Gedächtnisfeier für die gefallenen Schüler stand am Eingang plakatiert, darunter die Namen der Gefallenen. Mehr als hundert Schüler waren aufgelistet. Sogar Sechzehnjährige sind in den Krieg gegangen. Und gerade von den ganz jungen, den unerfahrenen, sind nur wenige heimgekehrt. In ihrer Seele verletzt, sind sie für das Lernen und Studieren auf ewig verdorben.
Ich muss dringlich mit Radke über eine Gedächtnisausstellung sprechen. Es soll mehr sein als ein einfaches Gedenken. Ein Vermächtnis soll es sein. Kein einfaches Erinnern, sondern ein Mahnen.
Man muss die Jungen gewinnen, dass sie die Werke der Toten würdigen und vollenden. Ob Radke mein Anliegen versteht? Ob ich überhaupt einem beibringen kann, was ich meine? Jetzt fehlt Ludwig, der so leicht diese Dinge in Worte zu fassen vermochte.
Die jungen Poeten sollen die Werke der gefallenen Maler und Bildhauer beschreiben. Die jungen Maler sollen die Lyrik und die Prosa der toten Dichter mit Graphiken illustrieren. Es soll eine Ausstellung werden und eine Lesung. Vielleicht findet man auch einen Komponisten, begabt, mit großer Zukunft, der auf dem Feld geblieben ist, dessen Musik soll der Rahmen sein. Ich wünschte mir, Radke gäbe mir freie Hand für dieses Projekt. Man muss in den Akademien anfragen und an den Kunstgewerbeschulen. Und Ernst muss genügend Finanzen bekommen, um einen ganz außergewöhnlichen Katalog aufzulegen.
 Die ersten Rezensionen zu dem neuen Krimi trudeln ein. Ich war gespannt, wie der zweite Teil bei den Lesern ankommt. Ich hätte nicht gedacht, dass das Schreiben einer Fortsetzung so schwierig ist und ich war froh, als es beendet war. „Nie mehr Krimi“, dachte ich danach. Aber jetzt kribbelt es schon wieder. Über Motive und Täter nachzugrübeln, den perfekten Mord zu planen und danach den Täter zu überführen, macht einfach Spaß.
Die ersten Rezensionen zu dem neuen Krimi trudeln ein. Ich war gespannt, wie der zweite Teil bei den Lesern ankommt. Ich hätte nicht gedacht, dass das Schreiben einer Fortsetzung so schwierig ist und ich war froh, als es beendet war. „Nie mehr Krimi“, dachte ich danach. Aber jetzt kribbelt es schon wieder. Über Motive und Täter nachzugrübeln, den perfekten Mord zu planen und danach den Täter zu überführen, macht einfach Spaß.